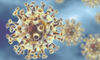In den vergangenen Monaten blieb es still um die Bemühungen der Schweizerischen Nationalbank, einen digitalen Franken für Finanzintermediäre zu kreieren. Das wird nicht so bleiben.
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) möchte sich nicht in die Karten blicken lassen und bereitet die Einführung einer digitalen Währung für den Finanzmarkt im Stillen vor – dies im Rahmen einer Machbarkeitsstudie im BIZ-Innovations-Zentrum. Die SNB lässt verlauten, dass es für konkrete Resultate noch zu früh ist, verspricht aber gleichzeitig, die Öffentlichkeit bei Gelegenheit zu informieren.
Die Gründe dafür, wieso sich die SNB eine Digitalwährung zwar für Finanzintermediäre vorstellen kann, nicht aber für normale Konsumenten bereitstellen möchte, sind an dieser Stelle schon ausführlich thematisiert worden.
Nicht zum Risiko gezwungen
Ein wichtiger Aspekt nimmt dabei die Rolle des Bargeldes ein, welches in der Schweiz nach wie vor vergleichsweise beliebt ist. In einer Antwort auf ein Postulat schrieb beispielsweise die Regierung Ende 2019, dass die Verfügbarkeit von Bargeld den Zugang zu Finanzdienstleistungen in der Schweiz gewährleistet und auch breite Akzeptanz geniesst.
In dieser komfortablen Lage sieht sich die Schweiz nicht gezwungen, die Risiken, welche mit einem digitalen Franken für die Allgemeinheit verbunden sind, einzugehen. So denkt die SNB, dass ein digitaler Franken in Krisenzeiten zu zusätzlicher ausländischer Nachfrage nach Schweizer Währung führen wird und damit den Aufwertungsdruck auf den Franken erhöht. Zudem würde das zweitstufige Bankensystem in Frage gestellt, weil die Bürger bei der SNB ein Frankenkonto führen könnten, was nach Auffassung der SNB nicht ihre Aufgabe ist.
Detailhandel ist unter Druck
Die Verwerfungen durch die Coronakrise könnten aber durchaus zu einer Neueinschätzung der Lage führen. Cash wird zwar in Krisenzeiten als sicheres Medium zur Aufbewahrung von Geld geschätzt, hat gemäss Banken gegenüber den elektronischen Zahlungsmittel an Terrain eingebüsst.
Zudem hat der Onlinehandel zuerst durch den Lockdown, dann aber in einer zweiten Phase auch wegen der allgemeinen Verunsicherung bezüglich Übertragbarkeit des Virus im öffentlichen Raum weitere Marktanteile gewinnen können, was nicht zuletzt zu einem Arbeitsplatzabbau bei Detailhändlern (beispielsweise bei Manor) geführt hat. Viele, nicht zuletzt die nicht verderblichen Konsumgüter, werden heute zu guten Teilen online eingekauft, weil sie auch immer weniger in Läden verfügbar sind.
Damit haben die grossen Handelsketten wie Amazon zusätzliche Marktmacht erlangt, welche der Einführung von alternativen Zahlungssystemen Vorschub leistet. Darum ist auch der Vorstoss des Facebook-Konzerns mit ihrem Libra-Projekt auf so viel Aufmerksamkeit gestossen.
Die geballte Macht von Silicon Valley
Ein Zahlungsmittel, welches auf den Datensätzen der Kommunikationsplattformen und der Handelsketten aufbaut, und welches die Nachteile des Währungsaustausches beseitigt, besitzt ein Potenzial, welches die Länder und Zentralbanken aufgeschreckt hat. Soweit ist es zwar noch nicht, aber die ersten Schritte sind vollzogen.
Indem die Libra-Initianten ihre Digitalwährung auf den wichtigsten Währungen der Welt aufbauen, werden zwar die Währungshüter dieser Länder beruhigt (siehe Stellungnahme der Finma im Frühjahr).
Aber für Schwellenländer ist eine alternative Weltwährung eine grosse Herausforderung, weil sie potenziell jegliche Umsetzung ihrer Währungspolitik verunmöglicht. Diese Zentralbanken kennen die Gefahr natürlich schon zur Genüge, weil sie gerade in Zeiten von Hyperinflation mit der Dominanz des U.S. Dollar zu kämpfen hatten (wie jetzt gerade in Zimbabwe zu beobachten).
Vorteile für die Bankenregulation
Dirk Niepelt, Professor der Volkswirtschaft an der Universität Bern und Direktor des SNB-Studienzentrums Gerzensee, ist überzeugt, dass nicht nur Schwellenländer, sondern auch die Schweiz in zehn Jahren ihre digitale Währung haben wird, und zwar auch für Konsumenten. Er sieht eine Reihe von Vorzügen durch die Einführung einer solche Währung. Am vielleicht wichtigsten dabei ist die Frage der «Too Big to Fail»-Problematik.
Mit der Einführung einer digitalen Währung, die von breiten Kreisen gehalten würde, verlören Bankenkrisen an Schrecken. Denn die Gefahr, dass ein Bankenzusammenbruch den Zahlungsverkehr beeinträchtigt, wäre reduziert. Die «Too Big to Fail»-Problematik wäre daher entschärft und regulatorische Anforderungen könnten gelockert werden.
Der Status Quo ist keine Option
Der entscheidende Impuls für die Einführung eines E-Frankens muss aber von der Politik kommen, ist Niepelt überzeugt. Eine solche fundamentale Neuerung des Geldsystems ist nicht Teil des Auftrags einer Zentralbank, sondern würde zwingend eine Involvierung der politischen Instanzen bedingen. Nicht zuletzt, weil die Risiken einer Einführung politischer Natur sind. Die SNB würde in eine neue Rolle gestossen und in ihrer Aufgabenerfüllung viel transparenter, was die Ansprüche an Quersubventionierungen noch weiter befeuern dürfte.
«Der Status Quo ist keine Option mehr», so Niepelt. «Die Währungshüter sind darauf bedacht, die Kontrolle über die Bezahlsysteme und den Finanzsektor aufrechtzuerhalten und die Attraktivität der eigenen Währung zu verteidigen.»