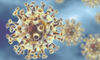Angeblich befindet sich die Credit Suisse in einer derart misslichen Lage, dass sie nur noch eins tun kann: Julius Bär zu übernehmen. Hinter diesem Ansinnen steckt keine Logik. Das Ganze macht keinen Sinn.
Sie würde grösser und bekäme einen neuen CEO – dies soll die Logik einer Credit Suisse (CS) sein, Julius Bär (JB) zu übernehmen? Es stimmt: Die CS kommt strategisch kaum vom Fleck, steckt in einer Identitätskrise und hat ein akutes Führungsproblem.
Mit der Übernahme des Private-Banking-Konkurrenten JB könnte sich die CS als globaler Wealth Manager emanzipieren, so die «Planspiele». Und mit Boris Collardi hätte sie einen neuen CEO, der diese neue Identität und Strategie glaubhafter vertreten würde als Brady Dougan, der auch nach sieben Jahren an der Spitze der CS im Herzen ein Investmentbanker geblieben ist.
Kulturell wären sich die beiden Häuser tatsächlich gar nicht mal so fremd: Bei JB in der Schweiz wimmelt es nur so von ehemaligen CS-Private-Bankern. Wenn Manager auf dieser Basis aber tatsächlich einen Deal aushecken, dann ist es um die betroffenen Unternehmen schlecht bestellt. Da steckt keine Logik dahinter. Eine massive Wertvernichtung wäre vielmehr die Folge.
Hier sind die grössten Denkfehler:
1. Julius Bär hat keinen Grund zu verkaufen:
Die Privatbank will wachsen, dafür hat sie das internationale Private-Banking-Geschäft von Merrill Lynch übernommen. Sie ist auf dem Weg zum global tätigen Wealth Manager und ist dynamischer unterwegs als die CS. In Asien ist sie ihr auf den Fersen, in Deutschland erreicht sie noch dieses Jahr die Gewinnschwelle. Die CS hat in den vergangenen Jahren in Deutschland bloss noch zum Rückzug geblasen.
Verwaltungsrat und Management von JB befinden sich auf einer Wachstumsmission und das Erreichte lässt sich sehen. In dieser Situation müsste ein Angebot der CS als unfreundlich taxiert werden. Und «unfriendly takeovers» funktionieren im Private Banking nicht. Sie vertreiben sowohl Kunden als auch Kundenberater der belagerten Bank.
2. Die CS hat das Geld gar nicht:
JB wird von der Börse derzeit mit 9,3 Milliarden Franken bewertet. Ein Angebot der CS müsste mit einer substanziellen Prämie ausgestattet sein. Allein: Die CS hat das Geld dafür gar nicht. Die US-Busse von 2,5 Milliarden Franken hat das Kernkapital der Grossbank unter die Marke von 10 Prozent gedrückt.
Diese Kennzahl will sie aber noch dieses Jahr erreichen, auch um ihren Aktionären eine Dividende zahlen zu können. Aus diesem Grund setzt die CS den Verkauf ihres Tafelsilbers fort. Ein Maklerbüro sucht derzeit Käufer für das geschichtsträchtige Griederhaus, in dem früher die Bank Leu untergebracht war.
Den zweistelligen Milliardenbetrag, den eine JB-Übernahme kosten würde, müsste sich die CS am Kapitalmarkt beschaffen. Die Finma sähe es in so einem Fall wohl lieber, wenn das Kapital zur Stärkung des Eigenkapitals verwendet würde, anstatt für eine grossspurige Akquisition.
Zwischenfazit: Die industrielle Logik fehlt
Diese Denkfehler würden schon genügen, den CS-JB-Deal zu Grabe zu tragen, bevor er richtig aus der Taufe gehoben ist. Gesetzt der Fall, dass Kapital kein Problem ist und die CS ein Angebot machte, welches JB nicht ausschlagen könnte, dann fehlt dem Deal noch immer die industrielle Logik:
3. Grösse ist kein Mittel zum Zweck:
Die CS ist als Wealth Manager nicht zu klein, um global bestehen zu können. Sie muss nicht Anschluss an die weit grössere UBS finden. Der mittelmässige Nettoneugeldzufluss und die verbesserungswürdige Profitabilität bei der CS haben andere Gründe als eine mangelnde Grösse.
Es gibt im Banking wie in der Industrie auch einfache Management-Grundsätze: Wird ein Unternehmen zu gross, geht Effizienz verloren. Es entstehen Reibungsverluste, anstatt Flexibilität etabliert sich Bürokratie.
Die geschätzten Skaleneffekte können nur entstehen, wenn auf einer bereits bestehenden Plattform höhere Geschäftsvolumen abgewickelt werden. Bei einer JB-Übernahme müssten zwei Plattformen global zusammengeführt werden – ein Mammut-Unterfangen mit wohl unabsehbaren Kosten.
4. Massive Doppelspurigkeiten in der Schweiz:
JB wie CS sind in der Schweiz hervorragend aufgestellt: Die CS unterhält rund 50 Private-Banking-Standorte. Die 14 Filialen der JB befinden sich ebenfalls in jenen Städten und Ortschaften, wo die CS präsent ist. Es müssten also allerhand Standorte geschlossen werden. Unter der Prämisse, dass das Schweizer Geschäft kaum mehr wächst, macht eine solche Aktion auch aus Kostengründen kaum Sinn.
5. Enorme Überlappungen in Asien:
Die CS ist in Asien der drittgrösste Vermögensverwalter. Die Julius-Bär-Gruppe, die Asien als ihren zweiten Heimmarkt bezeichnet, ist die Nummer 5. Beide Banken beschäftigen dort Tausende von Angestellten; bei einer Fusion käme es zwangsläufig zu einem personellen Blutbad – doch wer will das und zu welchem Zweck? Ob die zusammengeführten Plattformen auch die zur Kompensation notwendigen Kostenersparnisse bringen würden, steht in den Sternen.
6. Es kann nicht zwei Marken geben:
Die CS würde eine JB nicht übernehmen, um mit einer zweiten Marke weiterhin auf dem Markt zu bleiben. Der Markenname Julius Bär ist aber gleichzeitig viel zu wertvoll, als dass man ihn einfach streichen könnte. Ausserdem bindet die Marke Julius Bär Kunden, welche den Pure Player im Private Banking bewusst gewählt haben. Sie würden den Transfer zu einem Vermögensverwalter nicht schätzen, der seine Bilanz noch immer mit riskanten Investmentbank-Geschäften riskiert.
Fazit: Sollten die CS-Manager tatsächlich eine Übernahme von Julius Bär in Betracht ziehen, müsste man zwangsläufig annehmen, sie hätten aus den bitteren Erfahrungen der Mission «Clariden Leu» tatsächlich nichts gelernt. Mehr davon demnächst.